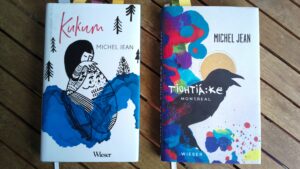Teil I: Neuwahlen in den Berliner Stadt-Wäldern. Beispiel Rixdorfer Wald – Berlin, 04. Oktober 2039
Im Rixdorfer Stadt-Wald wurde gestern wieder für fünf Jahre eine Wildnisschule zum „Hüter und Friedensstifter“ gewählt. In den Berliner Stadtwälder gibt es als Untergruppen die sogenannte „Nachbarschaft“, die sich um den lebendigen Wald in ihrer direkten Nähe kümmern. Das sind am Böhmischen Platz und in der Schudomastraße wieder die Nachbarschaft der dortigen Kneipen und Restaurants. Die Löwenzahn Grundschule kümmert sich jetzt schon zum dritten Mal um die Plätze und vier Straßen, die sie eingrenzen. Die Gazi Osman Pasa Moschee übernimmt erstmals die Schöneweider und einen Teil der Wipper Straße, Pan Afrika kümmert sich ebenso erstmals um einen Teil der Wipper-und die Kirchhofstraße. Für weitere fünf Jahre übernimmt die Brüdergemeinde die Sorge um die Kirchgasse und Teile der Richard- und Donaustraße. Um den Richardplatz kümmern sich nun ein neuer Zusammenschluss von Richardschule, die Buchhandlung Gute Seite, Gülays Kitchen und die Cocktailbar Herr Lindemann. Im Rat der einzelnen Nachbarschaften werden Freiwillige, Nachbarn, Experten, Älteste aufgenommen und gehört. Zwei Verantwortliche aus jeder Nachbarschaft und je zwei Hüter eines Stadtwaldes erhalten ein Bedingungsloses Grundeinkommen, damit sie möglichst unabhängig ihre Aufgaben übernehmen können.
In Rixdorf, ein Quartier in Berlin-Neukölln, ist in den letzten fünfzehn Jahren ein lebendiger Stadt-Wald entstanden, gelegen zwischen der Sonnenallee und der Karl-Marx-Straße, im Dreieck zwischen dem Rathaus Neukölln und dem S-Bahnring. Wir machen unsere Städte zu Wäldern. Städte wagen Wildnis wurde vom Bund unterstützt. In Berlin brachte 2026 der BaumEntscheid, eine erfolgreiche Volksabstimmung, einen wichtigen Anschub. In Berlin lautet der Slogan nun stolz: Wild und reich!
Wo es ging, in Höfen, auf Straßen und Plätzen wurden die Böden entsiegelt, Samen verstreut, Sträucher und Bäume gepflanzt, gepflegt, aber vor allem sich und ihrer wilden Kraft überlassen. Alles durfte in die Höhe, an den Wänden und auch auf den Dächern wachsen. Die Natur hat enorme Kräfte, will wachsen, blühen, das Leben feiern, sich hingeben, spenden und befruchten. Der Mensch ließ dies nun zu. Ende der 20er Jahre waren die Menschen vielen Krisen ausgesetzt. Es gab Kriege, Flucht, Armut, ein großes Artensterben, ökologische Katastrophen, Stürme, Überschwemmungen, das Land und vor allem die Städte wurden zu heiß. Ängste, Wut und Gewalt breiteten sich aus. Die Menschen hatten die eigene Kraft und Wildheit, den Sinn des Sein-an-sich verloren. Nun wurden sie wieder ein Teil des Lebens, des Großen Ganzen, der Nachbarschaft.
Im Rixdorfer Wald wurden Orte zu Wildnisplätzen mit Feuerstellen, Werkstätten, Orte für Austausch, Konfliktlösung und Finden von gemeinsam getragenen nachbarschaftlichen Entscheidungen. Viele unstrukturierte Freiräume entstanden, auf Höfen in Kitas und Schulen, auf Spielplätzen, in Brachen. In leerstehenden Garagen trifft man sich. Neue Verkehrsleitsysteme ermöglichen das Leben mit weniger Autos. Nun wird gespielt, gebaut, getauscht, verschenkt, repariert, geholfen und gefeiert. Teilhabe und Demokratie wurden wieder stark und gepflegt. Das politisch gesellschaftliche Denken wandelte sich. Die Kommunen gaben Macht ab, die Menschen vor Ort, die Nachbarschaften bekamen Gestaltungsmacht. Verwaltungen unterstützen. Hüter sind auch Friedensstifter. Die Nachbarschaften, die Nachbarn selbst, sorgen für Einigungsprozesse und den lebendigen Wald als ihre Heimat.
16.09.2024, Andreas Schönefeld, Wildnis- und Demokratiepädagoge
Teil II: 15 Jahre Wilde Heimat im Rixdorfer Stadt-Wald – Berlin, 11. November 2039
Vielleicht begann es am 11.11. vor fünfzehn Jahren? Wie jedes Jahr begann die närrische Zeit. Die Bürger nahmen es nun selbst in die Hand. Zukunftsgeschichten entstanden. Es war eine verrückte Zeit. Ein neuer, ehemaliger Präsident war gerade zum zweiten Mal gewählt worden. Seinen Wahlkampf hatte er gewonnen mittels Hetze, Lügen und sogenannten alternativen Fakten. Er gab den starken Mann, er spielte den Clown, den Unterhalter. Man hatte ihn nicht ernst genommen. In Deutschland musste der damalige Bundeskanzler seine Regierung auflösen. Es gab Neuwahlen. Gleichzeitig herrschte Krieg in Europa und Nahost. Auf Erden wurde das heißeste Jahr seit der Wetteraufzeichnungen gemessen. Es gab Flucht, Hunger und Naturkatastrophen. Auf allen Ebenen gab es Hass, üble Rede und Gewalt. Da machten sich an vielen, vielen Orten einzelne Menschen und Gruppen stark. Sie ermächtigten sich. Sie übernahmen Verantwortung. Sie begannen zu sprechen. Sie ergriffen das Wort. Sie entwickelten Visionen für eine gelingende Zukunft. Sie machten dann ihre Gemeinschaften und Netzwerke, sich gegenseitig stark und waren solidarisch. Jede/r sollte teilhaben und mitreden können. Neue und bewährte demokratische Prozesse, Information und Meinungsaustausch, das Gute Wort wurden zu Grundlagen der Entscheidungsfindungen, des Handelns und des Friedensstiftens.
In Berlin wurden die Stadt-Wälder erdacht und mittlerweile zur städtischen Heimat (wir berichteten davon am 04.10.2039). Berlin mit dem Slogan „Wild und reich!“ wurde zum Vorbild. Ein Umdenken breitete sich aus wie die neue Vielfalt, das Wilde vor Ort und das eigenen Wilde im Menschen selbst. Die Erkenntnis, Teil des Lebens zu sein wie alles andere Lebendige, setzte sich durch. Tiere, Pflanzen, Landschaften bekamen nach und nach Rechte zugesprochen. Politisch gesellschaftliches Denken erweckte Demokratie auf lokaler Ebene neu. Teilhaben, mitmachen, sich einmischen, seine Fähigkeiten einbringen machte widerstandsfähig, sich selbst und die lokale Gemeinschaft. Persönlich und konkret wurde mitgemacht. Die Stadt-Wälder wuchsen. Am Anfang half übrigens der Slogan „30% macht’s!“. Eine Rewilding-Bewegung hatte es geschafft, dass die Kirchen mit Ihren Friedhöfen, die Wohnungsbaugesellschaften mit ihren Grünflächen und Gartenbesitzer mit ihren Gärten, dort jeweils 30% wild machten und pflegten. Das war ein Auftakt für mehr Wildnis. Immer weitere machten mit. Kleine Quartiere wurden Stadtwälder. Dort gab es Hüter und Friedensstifter. Nachbarschaften und deren Räte kümmerten sich in den Wälder um ihre grünen Straßen und Plätze. Demokratie und Leben waren geschützt und solidarisch verbunden. Eine ökologisch-demokratische Transformation begann.
Für diesen Prozess wurde ein neu erschaffener Lokaljournalismus sehr wichtig. Alleine in Berlin-Neukölln, mit seinen gut 327.000 Einwohnern, wurden für den Norden und den Süden zwei Lokalredaktionen installiert. Finanziert wurde dieser unabhängige, gemeinnützige Journalismus durch staatliche Fördergelder und Stiftungen zur Stärkung der Demokratie. Berichtet wird in mehreren Sprachen über das Leben vor Ort, aus der Heimat der dort Aktiven und Wohnenden. Das damals neugegründete Publix in der Hermannstraße begleitet berlinweit die Demokratisierung und den Journalismus vor Ort. Im Außengelände des Publix, in einem teils wilden Friedhof, befindet sich ein zentraler, runder Tingplatz. Solche Beratungsrunden, Feuerstellen gibt es heute in jedem Stadtwald. In diesen Runden wird an den Erfolgsgeschichten gesponnen und gefeilt.
11.11.2024, Andreas Schönefeld, Wildnis- und Demokratiepädagoge
Teil III: Das neue Wilde Leben. Wild und frei – frei und verbunden – Berlin, 18. November 2039
Mut, Hoffnung, anpacken, Verantwortung übernehmen. Das machen, was jede/r gut kann. Die Herzen der Menschen bewegt das. Lebenswille und Widerstandskraft wächst. An den vielen Feuerstellen in den Berliner Stadtwäldern, in den Runden treffen sich diese Kräfte und verbinden sich. So sind es Orte der Zukunftsgeschichten und deren Umsetzung. Es sind Orte der Demokratie, der verbindenden Kommunikation und des Friedensstiftens.
Die Menschen vor Ort ermächtigten sich. Lokale Politik und Verwaltung gaben Macht ab. Frei und verbunden arbeiteten die Bürger zusammen. Neue gesellschaftliche Formen entstanden. Es gibt nun Hüter und Friedensstifter in den Stadtwäldern. Die Nachbarschaften und deren Räte sind Untergruppen für einzelne Straßen und Plätze. So entstanden vor 15 Jahren die Stadtwälder.
Begleitet und unterstützt wurden diese Prozesse durch Agenten aus verschiedenen Bereichen (Wildnispädagogik, Demokratieförderung, Mediation, Journalismus, Agrar- und Umweltwissenschaften, Waldsoziologie, Rechte für Natursubjekte und deren Vertretung, Forstwirtschaft, Gartenbau und Landschaftspflege, Stadtplanung, Handwerk, Verwaltung, Politik).
Wildnispädagogik hat zwei Seiten: Wildniswissen und Wildniskultur. Deren Philosophie erkennt und fördert die Verbundenheit allen Lebens und achtet und respektiert nichtmenschliches Leben, das Große Ganze. Wildniskulturell gibt es lange demokratische Traditionen der Verbindenden Kommunikation und des Friedensstiften mit Inneren Frieden, Guten Worten, Einigkeit und Heilung/Vergebung. Mit Runden, Redekreisen, Feuer, Tingplätzen werden zentrale Orte geschaffen. Geschichten erzählen ist eine uralte Kunst. Sie wird hier gepflegt. Mittels verschiedener Kunstformen lassen sich Bilder unserer Orte erzählen und erschaffen. Heimat, Netzwerke, gelingendes Zusammenleben werden so verdeutlicht und aktives lokales Engagement hervorgerufen.
Wildnispädagogen unterstützt und begleiten dabei verschiedenste Projekte:
- Rewilding aller Art, die Schaffung von Stadtwäldern, deren Kampagne „30% macht’s“, Hüter und Friedensstifter, Begleitung von Nachbarschaften und deren Räte
- Gemeinschaftsbezogene, soziale Projekte wie bezahlbare Wohnungen, Wohnungstausch, gemeinsame Wohnformen, Pflege. Tauschbörsen von Hilfeleistungen, Fertigkeiten, Werkzeugen, Handwerkskunst, Reparieren und Weiterverwerten
- Urbanes Gärtnern, Wildkräuter, Vielfalt und lebendiger Boden, solidarische Landwirtschaft
- Solidarisches Vorbereiten auf Katastrophen, Schaffung solidarischer Strukturen, Depots für Wasser, Lebensmittel, Lehmöfen, Outdoor-Kocher und Kochen, Sammeln von Solidarität und aller Fertigkeiten in Gemeinschaften, in der Nachbarschaft
- Spiel, Spaß, Neugier und entdecken, schmutzig und glücklich in Camps, auf Touren in Wilden Dörfern für alle Generationen
- Wiederbelebung einer Ältestenkultur, in der Älteste und Weise wichtige Aufgaben und Rollen in der Nachbarschaft ausfüllen
- Individuell Wandlungen und Übergänge leben, ausrichten, achtsam und kraftvoll, wild und frei – frei und verbunden
18.11.2024, Andreas Schönefeld, Wildnis- und Demokratiepädagoge
Teil IV: Da wächst was! Da tut sich was! – Berlin, 01. Dezember 2024 (Andreas Schönefeld)
Einzigartigkeit, eigene Größe und Schönheit zeigt sich, wächst heran, will immer an Licht. Jedes Leben trägt seine Bestimmung in sich, will wachsen, groß und schön werden, sich wandeln. Wie Blumen und Bäume, Tiere und Menschen. Dies passiert, gemeinsam, nebeneinander, wild und frei, frei und verbunden. Dies geschieht in Zyklen von Tag und Nacht, von Monden und Jahreszeiten, von Jahren und Perioden, in Prozessen von Geben und Nehmen, Leben und Tod, Wachsen und Vergehen.
Nur Mut! Jede/r kann Einzigartigkeit, Größe und Schönheit, Fähigkeiten und eigenes Wachstum einbringen in das Leben vor Ort zum Wohl aller. Was kann ich persönlich tun? Vor Ort? In meiner Nachbarschaft? Mich einbringen! Klein anfangen! Nur Mut!
- Da wächst was! Da tut sich was!
- Immer mehr kamen aus ihren Häusern, gingen nach draußen, um andere zu treffen, zu sprechen, gemeinsam nachzudenken, zu diskutieren. Man wollte teilhaben, gehört werden, sich einmischen und mitmachen für eine gute Zukunft.
- Draußen im Grünen, frühstückte man zusammen, aß zu Abend, einige schliefen sogar im Zelt oder unter offenem Himmel.
- Tiefgaragen wurden zu Werkstätten, Depots, Vorratsräumen.
- Hier gab es Werkstätten für Fahrräder, Reparaturen und Weiterverwertung.
- Solidarität und Fertigkeiten wurden gesammelt. Jede/r konnte sich da melden und einbringen. Vorräte und Werkzeuge, Pläne für Not- und Krisenfälle, für Naturkatastrophen wurden entwickelt.
- Debattierclubs entstanden. Omas gegen Rechts hatten jetzt auch mehr Opas. Die Boomer-Generation wurde aktiv.
- Wildnisplätze entstanden in Berlin. Es gab Wilde Dörfer, vormittags für Kita- und Schulkinder, nachmittags, abends und am Wochenende gab es Kurse, Wildniswissen und Wildniskultur, Treffen am Feuer für alle Generationen.
- Älteste kamen einfach vorbei, setzten sich dazu, beobachteten und sprachen, wenn sie gebraucht wurden.
- Senioren in Heimen und Wohngemeinschaften traf man im Grünen, in der kleinen Wildnis, im Busch vor dem Haus. Dort, wo auch Vögel, Eichhörnchen und Kinder sich wohl fühlten.
- Fast überall vor den Häusern gab es nun Bänke. Stufen wurden durch Rampen ersetzt für Rollstühle und Kinderwägen.
- In den Vorgärten, im neuen Grün, gab es Bänke, Wasser, Treffpunkte, Feuerrunden. Die Nachbar kümmerten sich darum.
- Die Bäume in den Straßen wurden gepflegt und bewässert. Urbanes Gärtner fand überall statt.
- Überall kümmerten sich Leute um einen Busch, um Grün, das voller Sperlinge war. Insektenhotels und Wildblumenwiesen entstanden.
- Spielorte, Werkstätten verbreiteten Lachen und geschäftiges Werken.
- Plätze wurden begrünt und belebt. Wilde Orte und Büsche entstanden in den Straßen, auf den Plätzen und vor den Häusern, in Vorgärten und auf Höfen.
- Gedruckte Stadtteilzeitungen gab es umsonst. Sie berichteten: Da wächst was! Da tut sich was!


Andreas Schönefeld
Andreas Schönefeld wohnt im Rixdorfer Wald

Böhmische Str. 52a, 12055 Berlin
01573 93 47 217
mit Corinna Thiesen
Wildnischule Wolf und Waldkauz
wildnisschule-wolfundwaldkauz.de
post@wildnisschule-wolfundwaldkauz.de
Die Wildnisschule Wolf und Waldkauz ist Kooperationspartner vom Waldtag des Kleinen Fratz auf dem Tipiplatz, Späthstr. 112
Wie wirkt dieser Text auf Sie? Ist es für Sie eine positive, animierende Geschichte?
Ein Blick in die nahe Zukunft, in der Sie gerne leben möchten? An der Sie sich gerne beteiligen? Die Sie mit aufbauen möchten? Als Nachbar, als Initiative, Gruppe, Partei, als staatliche Institution, als begleitende Presse?
Eignet sich diese Geschichte für die Suche nach Konzepten und Erzählungen, die wir gerne in einem größeren Verbund umsetzen wollen?
Dann kommen sie doch ans
Leuchtfeuer. Zukunftsgeschichten am Feuer erzählen, zuhören, entwickeln
Termine: montags 16:00 – 18:00 einmal im Monat (28.04. | 26.05. | 30.06. | 15.09. | 13.10. | 17.11.2025) auf dem Tipiplatz, Späthstr. 112